
«Es muss uns gelingen, diese Ungleichheiten zu beseitigen.»
Anne Lévy hat derzeit eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt inne. Als Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit muss sie die Schweizer Bevölkerung möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise bringen. Wie lange noch, bleibt abzuwarten. Trotz aller Turbulenzen glaubt Lévy jedoch, dass schliesslich auch diese Krise Chancen bietet: «Die Erfahrung, dass man Krisen nur im Kollektiv bewältigen kann, ist für mich sehr wertvoll», sagt Lévy.
Sehr geehrte Frau Lévy, Sie sind seit gut einem halben Jahr an der Spitze des BAG, und das steht seit über einem Jahr im Sturm der nicht endenden Corona-Krise. Was beschäftigt Sie aktuell (Ende April) am meisten?
Anne Lévy: Natürlich sind es die Covid-19-Themen, die mich aktuell am meisten beschäftigen. Die Impfstrategie, die jetzt gut vorankommt, die Teststrategie und das Covid-19-Zertifikat, an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten des Zertifikats sind aktuell noch in der politischen Diskussion.
Wie sieht Ihr Tagesablauf zurzeit aus? Haben Sie noch Zeit für Erholung?
Es sind lange Tage und lange Wochen. Aber ich nehme mir auch Zeit für Erholung. Ich gehe spazieren und versuche, zumindest die Zeiten fürs Abendessen einzuhalten. Dennoch ist das kein Zustand, den ich auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten möchte.
Was glauben Sie, wie lange wird diese Krisenzeit noch andauern?
Das kann niemand wissen. Es hängt auch davon ab, wie gross die Impfbereitschaft ist. Wenn viele bereit sind, sich impfen zu lassen, wird diese Pandemie schneller vorüber sein, als wenn das nicht der Fall ist. Es kommen kontinuierlich grosse Mengen an Impfdosen an. Auch wenn es vor Kurzem eine Verzögerung gab und das für die Kantone und die betroffenen Personen, die einen Termin für die Impfung hatten, sehr unglücklich war, sind wir weiterhin auf Kurs. Die Impfdosen wurden wenige Tage später nachgeliefert, und weitere Lieferungen treffen ebenfalls laufend ein. Wir kommen mit den Impfungen also gut voran.
Sind Sie zuversichtlich, dass die Bekämpfung der Krise gut vorangeht und die richtigen Entscheide gefällt wurden?
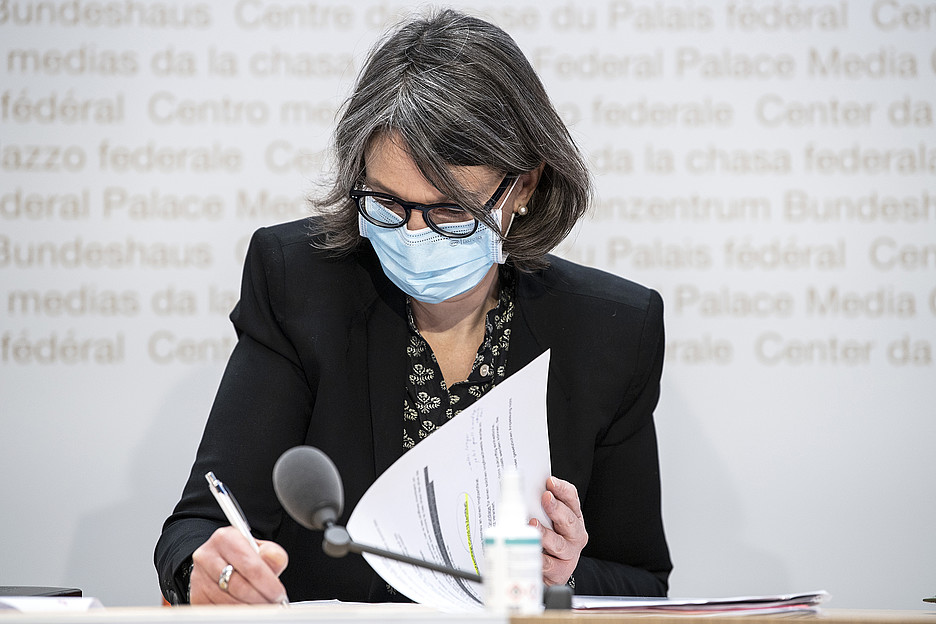
Es ist zu früh, um ein Fazit zu ziehen. Wir befinden uns in einer ausserordentlichen Situation. Dazu gehört auch, dass Fehler passieren. Auch uns sind Fehler passiert. Unser Wissen vergrössert sich jeden Tag. Allerdings ergeben sich auch immer wieder neue Herausforderungen, wie beispielsweise die Virusmutationen. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, jeweils rasch zu reagieren. Doch was gut und was falsch gelaufen ist, was man hätte besser machen können, werden wir nach Pandemieende abschliessend evaluieren und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Insgesamt bin ich aber zuversichtlich, dass wir mit unseren Impf- und Teststrategien auf gutem Weg sind. Wie sich die Situation weiterentwickeln wird, werden wir sehen. Wir haben in diesem Jahr Pandemie gelernt, dass es täglich neue Ereignisse gibt, die den Pandemieverlauf beeinflussen können.
Dennoch stehen Sie als BAG-Direktorin und damit als eine Hauptverantwortliche der Pandemiebekämpfung oft in der Kritik – wie wahrscheinlich all Ihre Kolleginnen und Kollegen in den meisten Ländern auch. Erhalten Sie neben der medialen Aufmerksamkeit auch viele Reaktionen aus der Bevölkerung?
Ja, wir erhalten viele Reaktionen, positive und negative. Das ist nicht verwunderlich, schliesslich ist die Corona-Pandemie ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und wir leben in einer Demokratie, in der jeder seine Meinung äussern können soll. Ich erhalte sehr viele Briefe und Mails von Leuten, die sich bedanken. Aber es gibt natürlich auch andere, die sich ärgern und uns kritisieren. Manchmal hat man dann das Gefühl, wir seien schuld an dieser Pandemie. Wir alle haben genug von der Corona-Krise und wünschen uns unser gewohntes Leben zurück. Diesen Frust kann ich gut nachvollziehen.
Sie erhalten also vor allem negative Reaktionen?
Dieser Eindruck wird wahrscheinlich durch die sozialen Medien verstärkt, wo die Hemmschwelle, sich negativ zu äussern, niedriger ist. Wer zufrieden ist und sich bedanken möchte, setzt sich einmal hin und schreibt ein paar Zeilen in einem Brief. Das ist dann einmalig, während diejenigen, die frustriert sind, in manchen Fällen wöchentlich in den sozialen Medien ihren Frust rausschreiben.
Nicht nur das Virus selbst, sondern auch die Auswirkungen der Krise haben gesundheitliche Folgen für manche Menschen. Hat das BAG Kenntnis über das Ausmass dieser Auswirkungen, beispielsweise in Form von psychischen Erkrankungen?
Wir haben uns intensiv mit diesem Thema befasst und die psychischen Auswirkungen der aktuellen Situation mit verschiedenen Studien beobachtet und dabei festgestellt, dass die Menschen sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen und natürlich auch sehr unterschiedlich betroffen sind. Es hängt von der Lebenssituation ab, also von den Belastungsfaktoren wie prekären Arbeitsverhältnissen, Armut oder Einsamkeit. Besonders betroffen sind die Heranwachsenden. Deshalb wurden Mitte April Öffnungsschritte gezielt für die Jugendlichen beschlossen, damit sie zum Beispiel wieder Sport in Gruppen treiben können; und nun sind auch die Universitäten zumindest für Veranstaltungen von jeweils 50 Studierenden wieder geöffnet. Trotzdem ist es ein verlorenes Jahr, was bei Älteren wohl weniger ins Gewicht fällt als bei den Jugendlichen.
Man war sich also immer im Klaren, dass die Schutzmassnahmen für die Bevölkerung eine teilweise grosse Belastung darstellen, die definitiv nicht mehr lange weitergeführt werden können?
Der Bundesrat hat von Anfang an versucht, eine Balance zwischen Gesundheit, persönlichen Freiheiten und Wirtschaft zu finden. Es gab bei uns in der Konsequenz viel weniger Einschränkungen als im Ausland. Es gab keine Ausgangssperren, und man konnte sich beispielsweise immer in kleinen Gruppen draussen treffen oder spazieren gehen. Auch die Schulen blieben seit Juni 2020 offen. Damit sind wir im internationalen Vergleich eines der wenigen Länder, welche die Schulen nur sehr kurz geschlossen hatten. Das war aus epidemiologischer Sicht ein gewisses Risiko, das jetzt mit der Einführung der breiten Testmöglichkeiten in den Schulen gesenkt werden konnte. Ich glaube, für die Kinder, die Jugendlichen und die Familien waren die offenen Schulen insgesamt sehr wichtig.

Welche Lehren gilt es für das BAG zu ziehen?
Für eine Bilanz ist es definitiv zu früh, aber die Evaluationen sind bereits im Gange. Grundsätzlich sind wir natürlich täglich daran, zu evaluieren, was gut lief, was nicht und was angepasst werden muss. Die grosse Kunst wird sein, die positiven Erfahrungen und Learnings mitzunehmen. Denn die Krise bietet auch Chancen. Denken Sie zum Beispiel an den Schub, den die Digitalisierung durch die Krise erfahren hat. Aber auch die Erfahrung, dass man Krisen nur im Kollektiv bewältigen kann, ist für mich sehr wertvoll. Der Austausch mit den Kantonen und anderen Partnern ist eng und gut und von Vertrauen geprägt. Wenn man das in die Zeit nach der Pandemie hinüberretten kann, dann ist viel erreicht. Daran arbeiten wir.
Gesundheit und Armut sind eng miteinander verbunden. Die Gesundheit und Lebenserwartung von Armutsbetroffenen ist deutlich schlechter bzw. tiefer. Die Pandemie verschärft diese Ungleichheiten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um dagegen etwas zu tun?
Die Beseitigung der Ungleichheiten ist eine der grossen Prioritäten der gesundheitspolitischen Strategie «Gesundheit2030» des Bundes, und sie ist auch eine meiner Prioritäten. Ich bin überzeugt, dass es diese Ungleichheit betreffend Gesundheit und Lebenserwartung in einem Land wie der Schweiz eigentlich nicht geben dürfte. Mit der Gesundheitsstrategie haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese Ungleichheit massiv zu verkleinern – auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, sie gänzlich zu beseitigen.
Mit welchen Massnahmen wollen Sie das erreichen?
Es geht um Prävention im Bereich Ernährung und Sucht, aber auch um Feinstaubbelastung. Und es geht auch darum, den Zugang zu Gesundheitsleistungen niederschwelliger zu machen.
Auch im Hinblick auf eine Corona-Erkrankung spielt sicher auch eine Rolle, dass sich Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, weniger testen lassen, später ärztliche Hilfe holen. War das ein Thema für Sie?
In der Pandemiebekämpfung haben wir uns von Anfang an darum bemüht, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Wir übersetzen die wichtigen Informationen in bis zu 24 verschiedene Sprachen. Sozial benachteiligte Personen zu erreichen, ist auch beim Impfen eine Herausforderung. Aus Umfragen lässt sich erkennen, dass gerade ärmere Bevölkerungsschichten dem Impfen gegenüber eher kritisch eingestellt sind. Um alle Bevölkerungsschichten zu erreichen, sind wir deshalb auch auf Partnerorganisationen angewiesen, die in Kontakt mit diesen Menschen stehen. Ich denke, das Impfen ist neben dem Testen und den Hygieneregeln das effektivste Mittel, um sich vor einer Erkrankung zu schützen. Aber auch die Abgabe der Selbsttests, die ja auch gratis sind, ist hier ein wichtiges ergänzendes Element. Mit diesen Massnahmen versuchen wir auf verschiedenen Wegen, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.
Erwarten Sie hier beispielsweise auch die Mitarbeit von Sozialdiensten?
Wir sind immer froh um alle Hinweise und Tipps, wie wir auch armutsbetroffene Menschen erreichen können. Aber wir sind in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen auch daran, in Unternehmen zu gehen, also dorthin, wo die Leute arbeiten, und Impfungen vor Ort anzubieten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man an bestimmte Orte mit mobilen Einheiten geht und den Menschen, die man vielleicht sonst nicht erreicht, Impfungen anbietet.
Die Kantone sind verpflichtet, Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen zu gewähren. Die SKOS stellt in ihrem zweijährlichen Monitoring fest, dass die Sozialhilfe einen erheblichen Anteil der KVG-Prämien übernehmen muss, weil die Kantone die Höhe der Prämienverbilligung zu tief ansetzen. Ist sich das BAG dieses Problems bewusst?
Wir sind uns bewusst, dass die Prämien eine bedeutende Belastung für die Haushalte darstellen. Die letztes Jahr eingereichte Prämien-Entlastungs-Initiative verlangt, dass maximal zehn Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien aufgewendet werden sollen. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass sich die Initiative nur auf die Finanzierung der Hilfsgelder konzentriert und die Kostendämpfung im Gesundheitswesen ausser Acht lässt. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative sieht nun vor, dass der Kantonsbeitrag zu den Prämienverbilligungen an die Bruttokosten im Gesundheitswesen geknüpft wird. Dadurch erhoffen wir uns eine verbindlichere Klärung der Prämienverbilligung.

Zurzeit läuft eine vom BAG in Auftrag gegebene Studie zur Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden. Gibt es dazu erste Resultate?
Die Ergebnisse dieser Studie liegen erst im August vor. Wir erwarten repräsentative und präzisere Hinweise auf den Gesundheitszustand von Sozialhilfebeziehenden in der gesamten Schweiz. Wir möchten auch wissen, wie Sozialhilfebeziehende die Versorgungsangebote in Anspruch nehmen. Ob sie auf Leistungen verzichten oder keinen Zugang zu Leistungen finden. Ein weiteres Thema ist die mangelnde Gesundheit als Hindernis für die Arbeitsmarktintegration. Aus anderen, weniger umfassenden Studien wissen wir, dass die körperliche und psychische Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden schlechter ist als in der übrigen Bevölkerung. Armut geht oft einher mit Gesundheitsproblemen und mit geringen Möglichkeiten, für die eigene Gesundheit zu sorgen.
Das Gesundheitssystem und das Sozialsystem arbeiten noch zu oft getrennt. Aus Sicht der SKOS werden Synergien zu wenig genutzt. Das Büro Vatter hat letztes Jahr dazu einen Bericht veröffentlicht. Was könnte verbessert werden?
Die Studie zeigt auf, dass eine engere Zusammenarbeit von Stellen der Sozialversicherungen mit medizinischem Fachpersonal sinnvoll sein könnte, um die Betreuung zu verbessern. An meiner früheren Stelle als CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken, UPK, in Basel ist es uns gelungen, die IV-Stelle des Kantons auf den Campus der UPK zu holen. Es hat sich herausgestellt, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn die Patientinnen und Patienten – sofern sie es möchten – schon während der Behandlung versuchen, mithilfe der IV-Stelle die Rückkehr an den Arbeitsplatz anzugehen. Es hat sich klar gezeigt, dass es ein guter Ansatz ist, beides von Anfang an zusammenzubringen. Es ist nicht nur aus Sicht der Sozialversicherungen ein Vorteil, sondern auch mit Blick auf die Gesundheit. Denn keine Arbeit zu haben, ist auch ein enormes Gesundheitsrisiko.
Welche möglichen Verbesserungen sähen Sie aufseiten der Sozialdienste?
Es ist nicht an uns, ihnen Ratschläge zu geben. Aber ich hoffe, dass den Kantonen und den betroffenen Stellen mit dieser und anderen Studien für sie wertvolle Grundlagen zur Verfügung stehen und auf den Handlungsbedarf aufmerksam machen. Bei der Prävention gilt immer je früher, umso besser.
Sie befassen sich zurzeit vermutlich hauptsächlich mit den Fragen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Bleiben andere Projekte liegen?
Leider mussten wir einige Projekte depriorisieren und nach hinten schieben.
Welche persönlichen Ziele möchten Sie im BAG erreichen?
Die Strategie «Gesundheit 2030» ist für mich elementar. Sie lag schon vor, als ich mein Amt im letzten Herbst übernahm. Wir werden sicher noch analysieren, was wir aus der Pandemie gelernt haben, und die Strategie allenfalls noch anpassen. Zentral für mich ist das Thema Digitalisierung. Nicht nur das BAG ist nicht genügend digitalisiert, sondern das ganze Gesundheitswesen. Das müssen wir angehen, auch wenn es eine riesige Aufgabe ist. Da sind wir aber nicht allein. Die Gesundheitssysteme sind weltweit bei der Digitalisierung eher etwas im Hintertreffen. Auch der Zugang zum Gesundheitssystem für alle ist für mich ein zentrales Thema. Es muss uns gelingen, diese Ungleichheiten zu beseitigen. Hier wird es vor allem darum gehen, die Gesundheitskompetenzen in der Bevölkerung zu verbessern. Dann möchte ich die Prävention auch von nicht übertragbaren Krankheiten wieder mehr in den Fokus rücken, von Krankheiten also, die durch Tabak, Alkohol, falsche Ernährung oder zu wenig Bewegung verursacht werden. Gerade in armutsbetroffenen Bevölkerungsschichten gibt es Handlungsbedarf. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist der One-Health-Ansatz, der Gesundheit ganzheitlich und im Zusammenspiel mit Tier, Mensch und Umwelt betrachtet. Die Feinstaubbelastung beispielsweise ist ein Umweltthema, das aber die Gesundheit des Menschen betrifft. Oder nehmen wir das Problem der Antibiotikaresistenzen. Es hilft nicht viel, wenn wir beschliessen, die Verwendung von Antibiotika beim Menschen besser zu steuern, ohne gleichzeitig den Einsatz von Antibiotika bei der Nutztierhaltung ebenfalls anzupassen. Das Antibiotikum kommt zudem über das Grund- und Trinkwasser wieder zu den Menschen zurück. Zu diesem Thema haben wir bereits eine Informationskampagne lanciert. Zur Umsetzung des One-Health-Ansatzes stehen wir selbstverständlich mit anderen Bundesämtern bereits in engem Kontakt.
Dann hoffen Sie, diese Themen nun bald wieder mit voller Energie verfolgen zu können?
Trotz der Pandemie sind wir in diesen Bereichen nicht untätig geblieben. Ein grosser Teil des Bundesamtes für Gesundheit kümmert sich durchaus noch um diese anderen Themen. Das Virus wird uns voraussichtlich auch noch ein paar Jahre begleiten und nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres in einer besseren Situation sind und andere Themen wieder mehr Gewicht erhalten.
Anne Lévy
Anne Lévy leitet seit 1. Oktober 2020 das Bundesamt für Gesundheit. Lévy war zuvor während fünf Jahren CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Zuvor leitete die 49-jährige gebürtige Bernerin mit Wohnsitz in Basel während sechs Jahren den Bereich Gesundheitsschutz im Gesundheitsdepartement von Basel-Stadt. Nach dem Studium der politischen Wissenschaften an der Universität Lausanne arbeitete Anne Lévy unter anderem als Spezialistin für Drogenfragen bei der Stadt Bern und im Bundesamt für Gesundheit. Dort leitete sie während fünf Jahren die Sektion Alkohol und Tabak. Anne Lévy verfügt über einen Executive MBA in Non-Profit-Organisations-Management der Universität Freiburg.