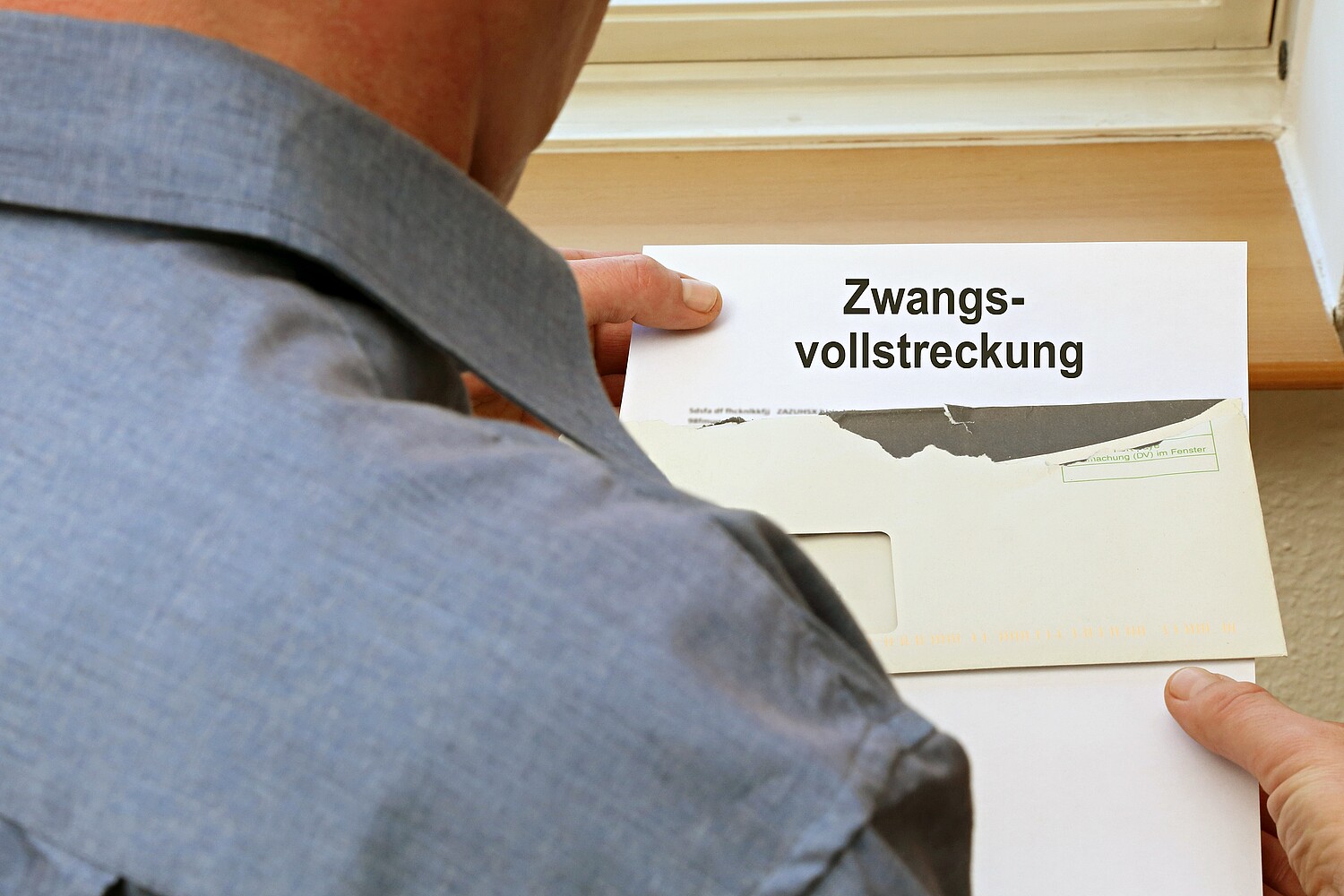
Prävention durch Eliminierung der strukturellen Schuldentreiber
In der Schweiz bestehen rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen, die eine Verschuldung von Privatpersonen begünstigen. Verschiedene Ansätze zu deren Neudefinition sind Gegenstand von mehreren politischen Rechtsetzungsvorhaben. Ihre politische Mehrheitsfähigkeit ist jedoch noch ungewiss.
Im Gegensatz zum umliegenden Ausland kennt man in der Schweiz weder einen direkten Abzug von Steuern vom Lohn noch einen solchen für Krankenversicherungsbeiträge. Im Kanton Zürich machten diese Kategorien im Jahr 2024 17,3 resp. 21,1 Prozent aller eingeleiteten Betreibungen aus. Ein weiterer Schuldentreiber ist, dass im Zwangsvollstreckungsverfahren die Steuern nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum eingerechnet werden. Die Schuldnerin wird somit am Ende des Pfändungsjahres zwangsläufig mit einer unbezahlten Steuerrechnung zurückgelassen. Was die Situation hierzulande zusätzlich noch erschwert, ist die lange Verjährungsdauer eines Verlustscheins von 20 Jahren (bis Ende 1996 war dieser sogar unverjährbar). Ein Verlustschein kann aber unbegrenzt neu betrieben werden (mit der Konsequenz der Verjährungsunterbrechung), womit er de facto nach wie vor unverjährbar wird. Dies kann eine fortgesetzte und konsequente Bewirtschaftung lukrativ machen. Schliesslich ist neben diesen intensiv schuldentreibenden Faktoren festzustellen, dass im Vergleich zu zahlreichen westeuropäischen Staaten (sowie den USA) in der Schweiz bislang kein Restschuldbefreiungsverfahren existiert.
Einrechnung der Steuern ins betreibungsrechtliche Existenzminimum (BEX)
Seit den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts stellte man sich auf den Standpunkt, die Berücksichtigung der Steuern sei für den Schuldner und seine Familie «nicht unbedingt» (Art. 93 SchKG) notwendig. Denn was als «notwendig» zu bezeichnen ist, ist selbstverständlich eine sozialpolitische Wertungsfrage. Unbestritten ist dabei aber, dass seinerzeit eine Pfändung zumeist mit der Verwertung eines Sachwertes (bspw. Möbelstück etc.) gedeckt werden konnte – die Lohnpfändung ihrerseits war statistisch eher die Ausnahme. Mit dem Verlust des Sachwertes von Gegenständen hat sich diese Situation reziprok verändert, was häufig zu seriellen Lohnpfändungen über Jahre hinweg führt.
Die Forderung nach Einrechnung der Steuern ins betreibungsrechtliche Existenzminimum fand vor Jahresfrist sowohl im National- als auch im Ständerat breite Unterstützung. Die Umsetzung ist hingegen knifflig: Welcher Betrag konkret soll denn nun ins BEX einberechnet werden (die Steuerlast wird erst im Jahr darauf festgestellt, die Pfändungsurkunde ist aber abgerechnet). Die Problematik ist wohl in analoger Form wie ein Quellensteuerabzug für Personen mit Aufenthaltsbewilligung abzuhandeln. Einer Nachverteilung (eines allfälligen verbleibenden Überschusses) zugunsten einer vorgehenden Gläubigerin steht die rasche und niederschwellige Abwicklung eines Betreibungsverfahrens entgegen.
Restschuldbefreiungsverfahren
Die Rechtskommission des Nationalrats berät gegenwärtig den bundesrätlichen Antrag : die Einführung eines Restschuldbefreiungsverfahrens für Privatpersonen. Wie angesprochen kennt die Schweiz kein solches Verfahren – dies obwohl es ja gerade in der Schweiz besonders wichtig wäre. Geplant ist, neben Anpassungen im vereinfachten Nachlassverfahren (Art. 331a–331g SchKG), insbesondere die Neuerung, dass eine Nichtäusserung eines Gläubigers zu einem ausgearbeiteten Nachlassverfahren als Zustimmung zu werten ist (Art. 331g lit. A), was als kleine, aber zielführende Änderung zu werten ist.
Als grosse Anpassung schlägt der Bundesrat sodann ein neu geschaffenes Sanierungskonkursverfahren für natürliche Personen vor: Nach gerichtlicher Eröffnung einer dreijährigen Lohnpfändungsperiode sollen einer schuldnerischen Person die bis zum Abschluss des Verfahrens noch offenen Forderungen zivilrechtlich verbindlich erlassen werden (womit offene Verlustscheine als nicht vollstreckbar erklärt werden). Dies, sofern die betroffene Person keine neuen offenen Verbindlichkeiten eingegangen ist. Diese richterliche Schuldenbefreiung ist aber an verschiedene Voraussetzungen geknüpft: die Auskunfts-, Herausgabe-, Mitwirkungs- und Berichterstattungspflicht der schuldnerischen Person sowie die Auflage, dass die von ihr geleisteten Bemühungen zur Erzielung von Erträgen und Einkünften nicht offensichtlich ungenügend gewesen waren.
Grund für die Verweigerung eines Restschuldbefreiungsverfahrens wären eine Verurteilung für Konkurs- oder Betreibungsverbrechen oder -vergehen bis zu zehn Jahre vor dem Verfahren. Sodann sind im Entwurf klar definierte Ausnahmen statuiert: So ist eine Entschuldung von familienrechtlichen Unterhaltsbeiträgen von vornherein ausgeschlossen – sofern für diese nicht das Gemeinwesen aufgekommen ist. Ebenso wenig ist ein Schuldenerlass für Bussen, Geldstrafen, Genugtuungsforderungen oder Rückerstattungs-forderungen für unrechtmässig bezogene Sozialhilfeleistungen möglich. Überdies würde ein nachträglicher Vermögensanfall (Erbschaft, Schenkung etc.) während fünf Jahren nachträglich zur Konkursmasse gezogen. Der Bundesrat ist zu Recht der Ansicht, dass hier ein austarierter und ausgewogener Kompromissvorschlag ausgearbeitet worden ist.
Regulierung von Verzugsschadenforderungen
Schliesslich ist auf einen weiteren Schuldentreiber zu verweisen: Nicht nur, aber insbesondere von Inkassounternehmen werden bei Zahlungsverzug einer schuldnerischen Person ergänzend zur Grundforderung teils happige Verzugsschäden geltend gemacht. Wenn eine schuldnerische Person nach Bezahlung der Grundforderung den Gläubiger um eine Löschung/Abstellung der Betreibung ersucht, wird sie feststellen müssen, dass der Gläubiger auf die Bezahlung von Verzugsschäden beharrt. Die Motion von Vincent Maître «Regelung und Deckelung der Gebühren von Inkassounternehmen» soll nun Abhilfe schaffen. Der Nationalrat hat sich unlängst für diesen Gesetzesauftrag ausgesprochen. Dieser ist nun in der Rechtskommission des Ständerates hängig. Die Motion ist jedoch strittig. Gegner der Motion halten die Verzugsschäden für nicht rechtmässig und lehnen die Motion deshalb ab. Faktisch leisten sie jedoch somit Schützenhilfe für die Inkassounternehmen und verhindern die dringende Lösung des Problems.
Monströse Forderungsbewirtschaftung
Sorgen bereitet mittlerweile ein neues und zunehmend verbreitetes Phänomen im Onlineshopping: Unter den angebotenen Zahlungsmodifikationen figuriert seit einiger Zeit ein Finanzinstitut (de facto eine Bank), das unmittelbar mit dem Onlinekauf Gläubiger der offenen Forderung wird, wodurch nicht mehr der Onlinehändler Gläubiger ist. Die Onlineshopper, meist junge Erwachsene, werden mit überaus geschmeidigen Slogans («Wir sind Problemlöser») und viel Werbung in den sozialen Medien zur Nutzung dieses Bezahlmodus verleitet. Bei Analyse der eingereichten Betreibungsbegehren ist von geschmeidiger Problemlösung dann aber wenig zu spüren: Die geltend gemachten Verzugsschäden sind in den allermeisten Fällen monströs! Hierbei wird klar, dass der Forderungskauf einzig und allein mit der Absicht erfolgt, ausstehende Forderungen gnadenlos zu bewirtschaften.
Staatliche Verlustscheinbewirtschaftung!
Genau weil Inkassounternehmen resp. internationale Finanzinstitute aus Sicht von schuldnerischen Personen in erster Linie Probleme eher bewirtschaften als lösen, gehören Verlustscheine von Krankenversicherern (aber auch von Steuerämtern) denn auch nicht in die Hände von privaten Inkassounternehmen. Die private Verlustscheinbewirtschaftung ist ein klarer Treiber der Verschuldung.
Die gegenwärtig zur Diskussion stehenden Gesetzgebungsprojekte sind ein Versuch, die einleitend genannten strukturellen Rahmenbedingungen der Verschuldung zu dämpfen. Aus Sicht der Praxis lohnt es sich, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen und inhaltlich überzeugende, nachhaltige und einfach umsetzbare Lösungen zu finden.